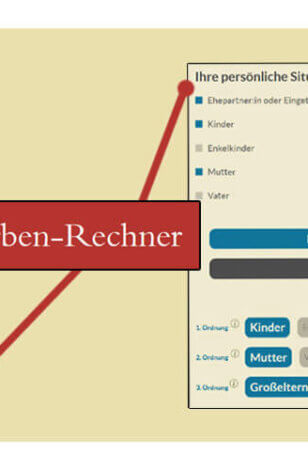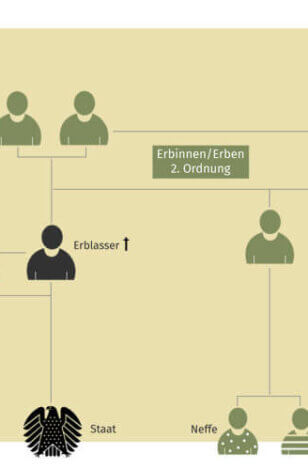Das Prinzip Apfelbaum präsentiert das Hamburg Stage Ensemble in den Städten Bonn, Frankfurt a.M., Wiesbaden, Köln und Duisburg
2024 geht das Hamburg Stage Ensemble bereits zum zweiten Mal mit der Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ auf Tour. Unter dem Motto „Vivaldi meets Piazzolla. Die acht Jahreszeiten“ treffen „Die vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi auf Astor Piazzollas „Die vier Jahreszeiten von Buenos Aires“.
Der Apfelbaum ist für diese einzigartige Kooperation aus Musik und gemeinnützigem Engagement das treffende Symbol: Man pflanzt ihn im Herbst, er gefriert im Winter, um im Frühling mit neuer Kraft aufzublühen und erneut Früchte zu tragen. Der Apfelbaum versinnbildlicht damit nicht nur die Vier Jahreszeiten, sondern auch den Zyklus von Leben, Tod, neuem Leben und Wachstum. Und die eigenen Werte über den Tod hinaus weiterzugeben und Bleibendes zu schaffen – das ist „Das Prinzip Apfelbaum“. Es ist Gutes, das immer wieder Früchte trägt.
Tickets für die Konzerte im April 2024 sind derzeit noch verfügbar: Hier geht es zu den Tourdaten und den Tickets.
Zurück